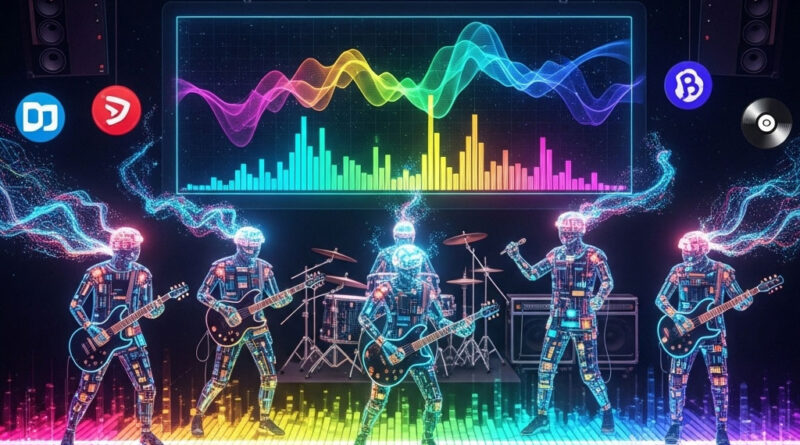KI-Bands: Wie Streamingdienste, Musikbranche und künstliche Intelligenz kollidieren
Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert derzeit viele Lebensbereiche – und macht auch vor der Musikindustrie nicht halt.
Während KI bisher vor allem als Werkzeug zur Optimierung von Produktionen oder zur Erkennung von Trends diente, hat sie nun selbst begonnen, Musik zu „machen“. Sogenannte KI-Bands, die vollständig von Algorithmen erzeugt werden, betreten den Markt – und werden gehört. Mit über einer Million monatlichen Hörern zählt das KI-Musikprojekt „The Velvet Sundown“ zu den prominentesten Beispielen. Doch was bedeutet das für Künstler, Labels, Streamingdienste – und nicht zuletzt für die Hörer?
The Velvet Sundown – KI trifft Mainstream
Ende Juni 2025 wurde bekannt, dass hinter der vermeintlich neuen Indie-Band „The Velvet Sundown“ keine menschlichen Musiker stehen, sondern eine künstliche Intelligenz. Die Tracks der Band wurden offenbar vollständig algorithmisch generiert – Musik, Gesang und Artwork eingeschlossen. Veröffentlichungen wie „Fake Memories“ oder „Lost in Analog“ klingen auf den ersten Blick wie typische Produktionen aus der Indie-Pop-Schublade. Und genau das ist das Problem: „Ich habe ihre Musik auf meine Playlist gesetzt, weil sie mich an The War on Drugs erinnerte – erst später habe ich erfahren, dass das keine echten Menschen sind“, sagte ein Nutzer auf Reddit.
Spotify, Apple Music und Deezer listeten die Songs ganz selbstverständlich. Die Titel schafften es sogar in von Spotify kuratierte Playlists wie „Fresh Indie“ oder „Chill Vibes“. Dass sich in Wirklichkeit keine menschliche Band dahinter verbirgt, war für viele eine Überraschung. Die Songs wirkten professionell produziert, emotional aufgeladen – und vor allem: vertraut. „Die KI wurde offenbar darauf trainiert, exakt das zu liefern, was algorithmisch gut funktioniert“, kommentierte Musikjournalist Jens Balzer.
Reaktionen der Streamingdienste
Die Enthüllung führte zu teils heftigen Reaktionen innerhalb der Branche. Deezer kündigte kurz darauf an, künftig alle KI-generierten Inhalte deutlich zu kennzeichnen. „Wir wollen keine Täuschung. Transparenz ist entscheidend“, sagte Deezer-CEO Jeronimo Folgueira. Auch Apple und YouTube zeigten sich offen für eine bessere Kennzeichnung.
Anders Spotify. Die Plattform betonte, dass sie keine KI-Inhalte priorisiere – aber sie auch nicht ausschließe. CEO Daniel Ek sagte in einem Interview: „Solange die Musik den Qualitätsstandards entspricht und keine Rechte verletzt, behandeln wir sie wie jede andere Musik.“ Diese Haltung sorgt für Protest. Musikerinnen und Musiker werfen Spotify vor, durch fehlende Regulierung gezielt KI-Musik zu pushen – weil sie günstiger und kontrollierbarer sei.
Der Protest formierte sich auch in Form eines Boykotts. Die Initiative „Real Music First“ rief Hörer und Künstler zum temporären Verzicht auf Spotify auf. Die Indie-Band „Low Points“ schrieb auf Instagram: „Wir treten ab sofort von Spotify zurück – bis echte Künstler wieder Priorität haben.“ Erste Labels äußerten Verständnis für diesen Schritt.
Zwischen Chance und Risiko
Effizienz, Kreativität, Demokratisierung
Die technische Seite ist beeindruckend. KI-Tools wie Suno oder Udio ermöglichen es, binnen Minuten ein Lied im gewünschten Stil zu erzeugen. Eingaben wie „Upbeat Indiepop mit Retro-Vocals und 80s-Synthesizer“ reichen aus, um ganze EPs zu generieren – inklusive Gesang.
Für Produzenten ist das ein Traum. „Es ist, als hätte ich ein Orchester auf Knopfdruck zur Verfügung“, beschreibt der Berliner Komponist Tom Ziegler seine Arbeit mit KI. Gleichzeitig eröffnet sich eine neue kreative Spielwiese. Hybride Musik – bei der Mensch und Maschine kooperieren – gilt als verheißungsvoller Trend. Der KI-gestützte Song „Now and Then“ der Beatles, veröffentlicht 2023, war ein frühes Beispiel.
Rechtliche Grauzonen und ökonomische Verwerfungen
Doch wo Chancen sind, sind auch Gefahren. Die Internationale Föderation der Phonografischen Industrie (IFPI) warnt davor, dass Songwriter durch KI-Inhalte bis zu 4 Milliarden Euro jährlich verlieren könnten. Die Algorithmen greifen häufig auf bestehende Musikstile, Stimmen oder Texte zurück – oft ohne Lizenz.
„Es ist, als würde man mit dem Werk anderer Leute neue Hits kreieren und daran verdienen – ohne zu zahlen“, so der britische Songwriter Billy Reeves. In den USA läuft bereits eine Klage gegen den KI-Musikanbieter Udio, dem vorgeworfen wird, Trainingsdaten illegal aus urheberrechtlich geschützten Quellen gezogen zu haben.
Auch das Thema Deepfakes ist ein Problem: In Tennessee wurde mit dem „Elvis Act“ ein Gesetz verabschiedet, das die kommerzielle Verwendung synthetischer Stimmen unter Strafe stellt – eine direkte Reaktion auf KI-Produktionen, die sich als bekannte Künstler ausgeben.
Vertrauenskrise beim Publikum
Die wohl größte Gefahr liegt in der schleichenden Erosion von Authentizität. Musik galt lange als zutiefst menschlicher Ausdruck – persönlich, verletzlich, einzigartig. Wenn diese Aura verloren geht, was bleibt dann noch?
Eine Nutzerin auf X (ehemals Twitter) schrieb: „Ich will Musik fühlen, nicht berechnen.“ Und genau darin liegt der Konflikt. KI kann täuschend echt klingen – aber sie hat kein Herz, keine Geschichte, keine Biografie. Für viele Fans ist das ein Bruch mit der Vorstellung von Kunst.
Regulatorische Herausforderungen
Der EU AI Act, im Frühjahr 2025 verabschiedet, verpflichtet Anbieter zur Offenlegung von KI-generierten Inhalten – allerdings nicht speziell in der Musik. Ein Flickenteppich nationaler Regeln macht die Lage unübersichtlich. Während Frankreich über ein Musiklabel-Gütesiegel nachdenkt, setzen deutsche Verwertungsgesellschaften auf technische Wasserzeichen.
Technologieanbieter wie Audoo oder Cyanite entwickeln derzeit sogenannte „AI Music Detectors“, die anhand von Klangprofilen erkennen sollen, ob ein Song von Menschen oder Maschinen stammt. Die Plattform DDEX arbeitet zudem an einem Standard zur expliziten Kennzeichnung von KI-Autoren und ‑Mitwirkenden.
Die Perspektiven der Beteiligten
- Künstler und Songwriter: fühlen sich zunehmend unter Druck. Sie fordern eine klare Trennung und faire Vergütung. „Wenn unsere Musik das Training für KI ist, wollen wir beteiligt werden“, so die Berliner Musikerin Yasmin Levy.
- Labels und Verwertungsgesellschaften: sehen ihre Geschäftsmodelle bedroht. Sony Music untersagt ausdrücklich die Nutzung ihrer Kataloge für KI-Training – und prüft rechtliche Schritte.
- Streamingplattformen: stehen zwischen Innovation und Verantwortung. Ein Manager von Deezer sagte anonym: „Wir können KI nicht ignorieren, aber wir müssen sie zähmen.“
- Hörer: zeigen sich gespalten. Während Tech-affine Nutzer KI-Musik als neue Klangwelt feiern, fordern viele eine Kennzeichnungspflicht. „Ich will wissen, ob ein Mensch dahintersteckt“, so ein Spotify-Nutzer in einer Umfrage von RND.
Ausblick und Empfehlungen
Es ist klar: KI wird nicht wieder aus der Musik verschwinden. Die Branche muss deshalb schnell Antworten finden. Experten schlagen drei zentrale Schritte vor:
- Verpflichtende Kennzeichnung: Jeder KI-generierte Track sollte als solcher markiert werden – in den Metadaten und sichtbar in der Nutzeroberfläche.
- Vergütungsmodelle: Wenn bestehende Musik zur KI-Generierung verwendet wird, müssen Rechteinhaber entschädigt werden – vergleichbar mit Sampling-Vergütungen.
- Ethik-Standards: Plattformen, Künstler und Entwickler sollten gemeinsam verbindliche Leitlinien für den KI-Einsatz entwickeln.
Zudem bieten hybride Formen – Mensch und Maschine in Zusammenarbeit – eine Perspektive, in der KI als Werkzeug und nicht als Ersatz wirkt. Beispiele wie die Popkünstlerin Holly Herndon, die ihre eigene Stimme als KI-Klon veröffentlichte, zeigen, wie produktiv ein bewusster Umgang sein kann.
Eine Zeitenwende
KI-Bands wie „The Velvet Sundown“ sind mehr als ein Trend – sie markieren eine Zeitenwende. Die Musikbranche steht am Scheideweg zwischen technischer Euphorie und kultureller Krise. Die Frage ist nicht mehr, ob KI Musik macht, sondern unter welchen Bedingungen und mit welchen Konsequenzen. Transparenz, Fairness und Respekt vor kreativer Arbeit sind dabei keine Bremsen – sondern notwendige Grundlagen für eine nachhaltige Musikzukunft.
Quellen (Auswahl):
RND, ZEIT ONLINE, SRF, T3N, WELT, musically.com, arxiv.org, Deezer Presse, IFPI, EU AI Act, Spotify Policy Blog